Shockley-Queisser-Grenze
Solarzellen sind elektrische Bauelemente, die Lichtenergie (in der Regel Sonnenlicht) direkt in elektrische Energie umwandeln.
Die Umwandlung geschieht gewöhnlich durch den inneren photoelektrischen Effekt (siehe auch Fotodiode oder Fotovoltaik).


Einteilung
Solarzellen kann man nach verschiedenen Kriterien einordnen. Das gängigste Kriterium ist die Materialdicke. Hier wird nach Dickschicht- und Dünnschichtzellen unterschieden.
Ein weiteres Kriterium ist das Material: Es werden zum Beispiel die Halbleitermaterialien CdTe, GaAs oder CuInSe eingesetzt, weltweit am häufigsten jedoch Silizium.
Die Kristallstruktur kann kristallin (mono-/polykristallin) oder amorph sein.
Neben Halbleitermaterialien gibt es auch neue Ansätze zum Material, wie organische Solarzellen oder Farbstoffsolarzellen.
Materialien
- Siliziumzellen
- Dickschicht
- Monokristalline Zellen (c-Si)
hohe Wirkungsgrade (großtechnisch bis über 20 % Wirkungsgrad erzielbar, gut beherrschte Technik; allerdings erfordert die Herstellung einen sehr hohen Energieeinsatz, der sich negativ auf die Energierücklaufzeit auswirkt. - Polykristalline Zellen (mc-Si)
inzwischen sind großtechnisch wohl Wirkungsgrade bis über 16 % möglich, relativ kurze Energierücklaufzeiten, bisher und wohl auch noch einige Zeit die Zelle mit dem günstigsten Preis-Leistungs-Verhältnis
- Monokristalline Zellen (c-Si)
- Dünnschicht
- Amorphes Silizium (a-Si)
höchster Marktanteil bei den Dünnschichtzellen; Modulwirkungsgrade zwischen 5 und 7 %; keine Material-Engpässe selbst bei Produktion im Terawatt-Maßstab - Kristallines Silizium, z. B. mikrokristallines Silizium (µc-Si)
in Kombination mit amorphem Silizium höhere Wirkungsgrade bis 10 %[1]; Herstellung ähnlich zu amorphem Silizium
- Amorphes Silizium (a-Si)
- Dickschicht
- III-V-Halbleiter Solarzellen
- GaAs-Zellen
hohe Wirkungsgrade, sehr temperaturbeständig, geringerer Leistungsabfall bei Erwärmung als kristalline Siliziumzellen, robust gegenüber UV-Strahlung, sehr teuer in der Herstellung, werden häufig in der Raumfahrt eingesetzt (Galliumindiumphosphid, GaInP/Galliumarsenid, GaAs/Germanium, Ge)
- GaAs-Zellen
- II-VI-Halbleiter Solarzellen
- CdTe
ist großtechnisch durch Chemical Bath Deposition sehr günstig herstellbar; für eine Laborsolarzelle sind schon etwa 16 % erreicht worden, Modul-Wirkungsgrade bisher noch deutlich unter 10 %, Langzeitverhalten noch nicht bekannt. Eine breite Markteinführung ist aufgrund der RoHS-Richtlinie allerdings unwahrscheinlich.
- CdTe
- CIS-, CIGS-Zellen
CIS steht für Kupfer-Indium-Diselenid bzw. Kupfer-Indium-Disulfid. Es existiert eine Pilotfertigung zur Fertigung von Kupfer-Indium-Diselenid-Modulen u.a. bei der Firma Würth Solar in Marbach am Neckar. Eine Pilotfertigung von Solarmodulen auf Basis von Kupfer-Indium-Disulfid steht bei der Firma Sulfurcell in Berlin. Es entsteht derzeit eine Pilotfertigung von Solarmodulen aus Kupfer-Indium-Gallium-Diselenid in Uppsala/Schweden. Diese Hersteller planen, ab 2007 Solarmodule in Massenproduktion herzustellen. - Organische Solarzellen
Die organische Chemie liefert Werkstoffe, die möglicherweise eine kostengünstige Fertigung von Solarzellen erlauben. Bisheriger Nachteil ist ihr deutlich schlechterer Wirkungsgrad und die recht kurze Lebensdauer (max. 5000 h) der Zellen. Es gibt noch keine kommerziell erhältlichen Zellen oder Module mit dieser Technologie (Stand Januar 2007). - Farbstoffzellen
oder auch Grätzel-Zellen nutzen organische Farbstoffe zur Umwandlung von Licht in elektrische Energie; ein Vorgang, der an die Photosynthese anlehnt. Sind meistens lila. - Halbleiter-Elektrolytzellen
z. B. Kupferoxid/NaCl-Lösung. Sehr einfach herstellbare Zelle, jedoch in Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit limitiert.
Materialverfügbarkeit
Silizium steht als Grundstoff für die Solarzellenproduktion in fast unbegrenzter Menge zur Verfügung. Materialengpässe, die durch unzureichende Produktionskapazitäten oder hohen Energieeinsatz hervorgerufen werden, sind aber möglich.
Bei exotischeren Solarzellenmaterialen wie z. B. beim Indium, Gallium, Tellur und Selen sieht die Situation grundlegend anders aus. Bei den seltenen Metallen Indium und Gallium überschreitet bereits derzeit der weltweite Verbrauch (Indium ca. 850 t, bei Gallium ca. 165 t) die jährliche Produktionsmenge um ein Mehrfaches (USGS Minerals Information). Besonders nachteilig ist der sehr stark steigende Verbrauch von Indium in Form von Indium-Zinn-Oxid in der Flüssigkristall- und OLED-Bildschirmherstellung, sowie die Verwendung von Gallium und Indium in der Produktion von Leuchtdioden, die sich als energiesparender Glühlampenersatz und als Hintergrundbeleuchtung für Flachbildschirme derzeit in der Markteinführung befinden.
Beim Indium wird daher noch in diesem Jahrzehnt mit einem Versiegen der Ressourcen gerechnet, da sich die theoretischen Indiumvorräte auf nur 6000 Tonnen, die ökonomisch abbaubaren Reserven auf sogar nur 2800 Tonnen belaufen. [2] [3]
Die Situation bei Selen und beim noch selteneren Tellur, beide Halbmetalle liegen in geringer Konzentration im Anodenschlamm der Kupferelektrolyse vor, erscheint auf den ersten Blick weniger kritisch, da die Kupferproduzenten zur Zeit nur einen Teil des in Metallelektrolyse anfallenden Anodenschlamms zur Selen oder Tellurgewinnung einsetzen. Die ökonomisch erschließbaren Selenreserven werden jedoch nur auf 82.000 Tonnen, die Tellurreserven gar auf nur 43.000 Tonnen geschätzt. Dem stehen zum Beispiel beim ebenfalls nicht besonders häufigen Buntmetall Kupfer Reserven von 550 Millionen Tonnen gegenüber.
Problematisch ist, dass viele Produktionsprozesse, in denen Gallium, Indium, Selen und Tellur eingesetzt wird, eine ungünstige Materialökonomie aufweisen.
Recyclingansätze, die z. B. beim Kupfer zum normalen Materialkreislaufs gehören, greifen bei Gallium, Indium, Selen und Tellur nicht. Die Materialien werden meist in komplexe Vielstoff-Schichtstrukturen eingebunden und dadurch so fein verteilt, dass eine Rückgewinnung auch in Zukunft nicht möglich sein wird.
Bauformen
Neben dem Material ist die Bauweise von Bedeutung. Man unterscheidet verschiedene Oberflächenstrukturierungen und Anordnungen der Kontaktierung der transparenten, jedoch hochohmigen Deckelektrode (schmale oder sogar durchsichtige Kontakte).
Weitere Bauformen sind Stapeltechniken durch Materialkombinationen unterschiedlicher Absorptionswellenlängen, wodurch der Wirkungsgrad der Gesamtanordnung erhöht werden kann. Es wird versucht, die Materialien so zu wählen, dass das einfallende Sonnenspektrum maximal ausgenutzt wird.
Derzeitig sind kommerziell erhältliche Solarzellen aus Halbleitermaterialien, überwiegend aus Silizium. Auch III/V-Halbleitermaterialien werden verwendet (u.a. an Raumsonden). Wegen ihrer hohen Kosten werden sie für terrestrische Anwendungen in Konzentrator-Systemen verwendet.
Polymere Solarzellen befinden sich noch in der Forschung.
Halbleitersolarzellen werden zur Energiegewinnung meist zu großen Solarmodulen verschaltet. Die Zellen werden dafür mit Leiterbahnen an Vorder- und Rückseite in Reihe geschaltet. Dadurch addiert sich die Spannung der Einzelzellen und es können dünnere Drähte für die Verschaltung verwendet werden als bei einer Parallelschaltung. Als Schutz vor einem Lawinendurchbruch in den einzelnen Zellen (z.B. bei Teilabschattung) müssen jedoch zusätzlich Schutz-Dioden (Bypass-Dioden) parallel zu den Zellen eingebaut, die von Abschattung betroffene Zellen überbrücken können.
Solaranlagen werden manchmal mit einer mechanischen Nachführung ausgestattet. Die Solaranlage wird dadurch elektrisch dem Sonnenstand angepasst, um die Ausbeute an elektrischer Energie aus der Sonnenenergie zu erhöhen.
Der theoretisch maximale thermodynamische Wirkungsgrad der Energiegewinnung aus Sonnenlicht beträgt 85 %. Er folgt aus der Sonnentemperatur von 5800 K, der maximalen Absorbertemperatur (<2500 K, Schmelzpunkt von Hochtemperaturwerkstoffen) und der Umgebungstemperatur (300 K).
Wird nur ein begrenzter Wellenlängenbereich aus dem Sonnenspektrum genutzt, reduziert sich der theoretische Wert, beispielsweise für Solarzellen auf Siliziumbasis auf 29%. Das ist ein prinzipieller Nachteil von Solarzellen gegenüber solarthermischen Kraftwerken, da Solarzellen immer nur einen Teil des Spektrums nutzen können.


Funktionsprinzip


Solarzellen aus Halbleitermaterialien sind im Prinzip wie großflächige Photodioden aufgebaut. Sie werden jedoch nicht als Strahlungsdetektor, sondern als Stromquelle betrieben.
Die Besonderheit von Halbleitern ist die, dass sie durch zugeführte Energie (Wärme oder Licht) freie Ladungsträger erzeugen (Elektronen und Löcher, siehe Generation). Um aus diesen Ladungen einen elektrischen Strom zu erzeugen, ist ein internes elektrisches Feld nötig, um die erzeugten Ladungsträger in unterschiedliche Richtungen zu lenken.
Dieses interne elektrische Feld wird durch einen p-n-Übergang erzeugt. Da Licht in Materialien gewöhnlich exponentiell schwächer wird, muss dieser Übergang möglichst nahe an der Oberfläche liegen, und die Übergangszone mit dem elektrischen Feld sollte möglichst weit in das Material hineinreichen. Diese Übergangszone (Raumladungszone) wird durch gezielte Dotierung des Material eingestellt (siehe Halbleitertechnologie). Um das gewünschte Profil zu erzeugen, wird gewöhnlich eine dünne Oberflächenschicht stark n-dotiert, die dicke Schicht darunter schwach p-dotiert. Dies hat eine weitreichende Raumladungszone zur Folge. Wenn in dieser Übergangszone nun Photonen einfallen und Elektronen-Loch-Paare erzeugen, so werden durch das elektrische Feld die Löcher zum untenliegenden p-Material beschleunigt und umgekehrt die Elektronen zum n-Kontakt auf der (sonnenzugewandten) Oberseite. Ein Teil der Ladungsträger rekombiniert auf dieser Strecke und geht in Wärme verloren, der übrige Strom (Photostrom) kann direkt von einem Verbraucher benutzt, in einem Akkumulator zwischengespeichert oder mit einem netzgeführten Wechselrichter in das Stromnetz eingespeist werden. Die elektrische Spannung bei maximaler Leistung (Maximum Power Point, Leistungsanpassung) liegt bei den gebräuchlichsten Zellen (kristalline Siliziumzellen) bei etwa 0,5 V.
Die Struktur von Solarzellen wird weiterhin so angepasst, dass möglichst viel Licht eingefangen und in der aktiven Zone Ladungsträger erzeugen kann. Dazu muss die Deckelektrode transparent sein, die Kontakte zu dieser Schicht müssen möglichst schmal sein, auf der Oberseite wird eine Antireflexionsschicht zur (Verringerung des Reflexionsgrades) aufgetragen. Die Antireflexionsschicht sorgt für die typisch bläuliche bis schwarze Farbe von Solarzellen. Unbeschichtete Solarzellen haben dagegen ein silbrig-graues Erscheinungsbild.
Manchmal wird die Vorderseite strukturiert oder aufgeraut. Wegen dieses Vorteils wurden ursprünglich Wafer mit Fehlern beim Schleifprozess o.a. als Ausgangsmaterial für Solarzellen verkauft.
Die Antireflexschicht wird bei modernen Solarzellen aus Siliziumnitrid mittels PE-CVD Verfahren hergestellt. Die Schichtdicke beträgt dabei ca. 70 nm (Lambda-Viertel bei einer Brechzahl von 2,0). Des weiteren kommen noch Antireflexschichten aus Siliziumdioxid und Titandioxid, die beispielsweise per AP-CVD Verfahren aufgebracht werden, zur Anwendung.
Über die Schichtdicke wird auch die Farbe bestimmt (Interferenzfarbe). Eine möglichst hohe Gleichmäßigkeit der Beschichtungsstärke ist dabei wichtig, da bereits Schwankungen um einige Nanometer in der Schichtstärke den Reflexionsgrad erhöhen. Blaue Reflexion ergibt sich aus der Einstellung der Antireflexschicht auf den roten Teil des Spektrums - der bevorzugten Absorptionswellenlänge des Silizium. Prinzipiell sind jedoch auch beispielsweise rote, gelbe oder grüne Solarzellen auf diese Weise für spezielle architektonische Anwendungen herstellbar, sie haben jedoch einen schlechteren Wirkungsgrad.
Im Falle von Siliziumnitrid und Siliziumdioxid erfüllt die Antireflexschicht dabei noch die Funktion einer Passivierungsschicht, welche die Oberflächenrekombinationsgeschwindigkeit herabsetzt. Die an der Oberfläche erzeugten Ladungsträger können dadurch - vereinfacht ausgedrückt - nicht so schnell rekombinieren und die erzeugte Ladung kann als Spannung abgegriffen werden.
Typen von Silizium-Solarzellen


Das traditionellste Grundmaterial für Halbleitersolarzellen ist Silizium. Wurden früher eher Abfallmaterialien für die Herstellung von Solarzellen verwendet, so wird inzwischen ein großer Anteil speziell gefertigter Materialien eingesetzt. Silizium ist allgemein für die Halbleitertechnik nahezu ideal. Es ist preiswert, lässt sich hochrein und einkristallin herstellen und als n- und p-Halbleiter dotieren. Einfache Oxidation ermöglicht die Herstellung dünner Isolationsschichten. Jedoch ist die Ausprägung seiner Bandlücke als indirekter Halbleiter für optische Wechselwirkung wenig geeignet. Siliziumbasierte kristalline Solarzellen müssen eine Schichtdicke von mindestens 100 µm und mehr aufweisen, um Licht ausreichend stark zu absorbieren. Bei Dünnschichtzellen direkter Halbleiter, wie z. B. Galliumarsenid oder auch Silizium mit stark gestörter Kristallstruktur (siehe unten), genügen 10 µm.
Je nach Kristallaufbau unterscheidet man bei Silizium folgende Typen:
- Monokristalline Zellen werden aus sogenannten Wafern (einkristalline Siliziumscheiben) hergestellt, wie sie auch für die Halbleiterherstellung verwendet werden. Sie sind verhältnismäßig teuer.
- Multikristalline Zellen bestehen aus Scheiben, die nicht überall die gleiche Kristallorientierung aufweisen. Sie können z. B. durch Gießverfahren (s. u.) hergestellt werden und sind preiswerter und in Photovoltaik-Anlagen am meisten verbreitet. Häufig werden diese Zellen auch als polykristalline Solarzellen bezeichnet.
- Amorphe Solarzellen bestehen aus einer dünnen, nicht-kristallinen (amorphen) Siliziumschicht und werden daher auch als Dünnschichtzellen bezeichnet. Sie können z. B. durch Aufdampfen hergestellt werden und sind sehr preiswert, haben im Sonnenlicht einen nur geringen Wirkungsgrad, bieten jedoch Vorteile bei wenig Licht. Zu finden sind die amorphen Zellen beispielsweise auf Taschenrechnern oder Uhren.
- Mikrokristalline Zellen sind Dünnschichtzellen mit mikrokristalliner Struktur. Sie weisen einen höheren Wirkungsgrad als amorphe Zellen auf und sind nicht so dick wie die gängigen polykristallinen Zellen. Sie werden teilweise für Photovoltaikanlagen verwendet, sind jedoch noch nicht sehr weit verbreitet.
- Tandem-Solarzellen sind übereinandergeschichtete Solarzellen, meist eine Kombination von polykristallinen und amorphen Zellen. Die einzelnen Schichten bestehen aus unterschiedlichem Material und sind so auf einen anderen Wellenlängenbereich des Lichtes abgestimmt. Durch ein breiteres Ausnützen des Lichtspektrums der Sonne haben diese Zellen einen besseren Wirkungsgrad als einfache Solarzellen. Sie werden teilweise auf Fotovoltaikanlagen verwendet, sind jedoch noch relativ teuer. Eine deutliche Verbilligung wird durch eine Kombinations mit Linsensystemen erzielt, so genannten Konzentratorsystemen.
Herstellung aus Siliziumblöcken oder -stäben
Traditionelle Solarzellen können nach verschiedenen Verfahren hergestellt werden.

Das Grundmaterial Silizium ist das zweithäufigste chemische Element, das in der Erdkruste vorkommt. Es liegt in Form von Silikaten oder als Quarz vor. Aus Quarzsand kann in einem Hochofenprozess Rohsilizium, sogenanntes metallurgisches Silizium, mit Verunreinigungen von circa 1 -2 % hergestellt werden. 2002 wurden auf diese Weise 4,1 Mio Tonnen Silizium hergestellt. Ein Großteil davon geht in die Stahlindustrie und in die Chemische Industrie. Nur ein kleiner Anteil des metallurgischen Siliziums wird für die Mikroelektronik und die Photovoltaik verwendet.
Aus dem Rohsilizium wird dann über einen mehrstufigen auf Trichlorsilan basierenden Prozess polykristallines Reinstsilizium hergestellt.
Der bis heute (2006) hier angewendete Siemens-Prozess ist ein CVD-Verfahren. Es wurde allerdings für die Mikroelektronik entwickelt und optimiert. Dort werden zum Teil völlig andere Anforderungen an die Qualität des Siliziums gestellt als in der Photovoltaik. Für Solarzellen ist beispielsweise die Reinheit des Wafers in seiner gesamten Stärke wichtig, um ein möglichst lange Ladungsträger-Lebensdauer zu gewährleisten. In der Mikroelektronik müssten dagegen prinzipiell nur die oberen ca. 20-30 µm hochrein sein. Da mittlerweile der Verbrauch an hochreinem Silizium für die Photovoltaik den Verbrauch in der Mikroelektronik übertroffen hat, wird zur Zeit intensiv an speziellen, kostengünstigeren und für die Photovoltaik optimierten Herstellverfahren für Solarsilizium gearbeitet.
Der gesamte Herstellprozess für hochreines Silizium ist zwar sehr energieaufwändig, aber dennoch können die heute verwendeten Solarzellen die für ihre Produktion erforderliche Energiemenge - je nach Bauart - innerhalb von 1,5 bis 5 Jahren wieder kompensieren. Sie haben also eine positive Energiebilanz.
Das Reinstsilizium kann auf sehr unterschiedliche Weise weiterverarbeitet werden. Für multikristalline Zellen kommen größtenteils das Gießverfahren, das Bridgman-Verfahren und das Bandzieh-Verfahren (EFG-Verfahren) zum Einsatz. Monokristalline Zellen werden fast immer nach dem Czochralski-Verfahren hergestellt. Bei allen Verfahren gilt, dass die Dotierung mit Bor (siehe unten) schon beim Herstellen der Blöcke (Ingots) beziehungsweise Stäbe vorgenommen wird.
Blockgussverfahren
Dieses Verfahren dient zur Herstellung von multikristallinem Silizium. Das Reinstsilizium wird in einem Tiegel mit Hilfe einer Induktionsheizung aufgeschmolzen und dann in eine quadratische Wanne gegossen, in der es möglichst langsam abgekühlt wird. Dabei sollen möglichst große Kristallite in den Blöcken entstehen. Die Kantenlänge der Wanne beträgt etwa 50 cm, die Höhe der erstarrten Schmelze etwa 30 cm. Der große Block wird in mehrere kleine Blöcke von etwa 30 cm Länge zerteilt.
Ein weiteres Gießverfahren ist der Strangguss, wobei die Masse schon in der am Ende benötigten Stärke auf das Trägermaterial aufgebracht wird. Der Vorteil ist, dass ein Sägevorgang mit seinen Verlusten entfällt.
Bridgman-Verfahren
Das Bridgman-Verfahren dient ebenfalls zur Herstellung von multikristallinem Silizium. Das Reinstsilizium wird hier ebenfalls in einem Tiegel mit Hilfe einer Induktionsheizung aufgeschmolzen. Die langsame Abkühlung der Schmelze, bei der sich große Zonen einheitlicher Kristalle ausbilden, findet hier im gleichen Tiegel statt. Die geheizte Zone wird langsam von unten nach oben im Tiegel angehoben, so dass sich oben bis zum Schluss flüssiges Silizium befindet, während vom Tiegelboden her das Erstarren erfolgt. Hier sind die Kantenlängen etwas größer als beim Gießverfahren (etwa 60 bis 70 cm), die Höhe des Blocks beträgt etwa 20 bis 25 cm. Der große Block wird ebenfalls in mehrere kleine Blöcke von etwa 20 bis 25 cm Länge zerteilt.
Czochralski-Verfahren
Das Czochralski-Verfahren wird für die Herstellung von langen monokristallinen Säulen genutzt. Der so genannte Impfkristall gibt die Orientierung im Kristall vor. Vor der Herstellung der Zellen wird der entstandene Zylinder noch zurechtgeschnitten.
Zonenschmelzverfahren
Das Zonenschmelzverfahren, auch Float-Zone-Verfahren genannt, dient auch der Herstellung monokristalliner Siliziumstäben. Die bei diesem Verfahren erzielte Reinheit ist im Normalfall höher als für die Solartechnik benötigt und auch mit sehr hohen Kosten verbunden. Deshalb wird diese Technik für die Solartechnik eher selten benutzt. Das einzige Unternehmen das Float-Zone-Wafer in nenneswerten Mengen für Solarzellen verwendet, ist das US-Unternehmen SunPower.
Waferherstellung
Die Kristallstäbe müssen nun mit einem Drahtsägeverfahren in Scheiben, die sogenannten Wafer, gesägt werden. Dabei entsteht aus einem großen Teil des Siliziums Sägestaub, der derzeit nicht mehr verwendbar ist. Die Dicke der entstehenden Scheiben liegt bei etwa 0,18…0,28 mm.
Eine weitere Quelle für Wafer war früher der Ausschuss an Rohlingen für die Herstellung von integrierten Schaltkreisen der Halbleiterfertigung. Sind die Rohlinge dort zur Weiterverarbeitung nicht geeignet, können sie teilweise noch als Solarzelle verwendet werden. Mit den heutigen (2005) Herstellungsverfahren und dem enorm gestiegenen Bedarf der Solarindustrie hat die Verwendung von Ausschuss heute keine Bedeutung mehr.
Die monokristallinen Zellen zeichnen sich durch eine homogene Oberfläche aus, während bei den multikristallinen Zellen gut die einzelnen Zonen mit verschiedener Kristallorientierung unterschieden werden können - sie bilden ein eisblumenartiges Muster auf der Oberfläche.
Im Waferstadium sind Vorder- und Rückseite der Zelle noch nicht festgelegt.
Waferprozessierung
Die gesägten Wafer durchlaufen nun noch mehrere chemische Bäder, um Sägeschäden zu beheben und eine Oberfläche auszubilden, die geeignet ist, Licht einzufangen. Hier gibt es verschiedene, herstellerspezifische Konzepte.
Im Normalfall sind die Wafer schon mit einer Grunddotierung mit Bor versehen. Diese bewirkt, dass es überschüssige freie Löcher (positive Ladungen) gibt, das heißt, es können Elektronen eingefangen werden. Dies wird auch p-Dotierung genannt. Auf dem Weg zur fertigen Solarzelle mit p-n-Übergang muss nun die Oberfläche noch eine n-Dotierung bekommen, was durch Prozessierung der Zelle in einem Ofen in einer Phosphor-Atmosphäre geschieht. Die Phosphoratome schaffen eine Zone mit Elektronenüberschuss auf der Zelloberfläche, die etwa 1 µm tief ist.
Danach erfolgt die Bedruckung der Zelle mit den notwendigen Lötzonen und der Struktur, welche für den besseren Abgriff des generierten elektrischen Stroms sorgt. Die Vorderseite erhält meist zwei breitere Streifen, auf denen später die Bändchen zum Verbinden mehrerer Zellen befestigt werden. Außerdem wird ein sehr dünnes, elektrisch gut leitendes Raster aufgebracht, was einerseits den Lichteinfall so wenig wie möglich behindern und andererseits den ohmschen Widerstand der Deckelektrode verringert. Die Rückseite wird meist vollflächig mit einem gut leitenden Material beschichtet.
Nach der Prozessierung werden die Zellen nach optischen und elektrischen Merkmalen klassifiziert, sortiert und für die Fertigung von Solarmodulen zusammengestellt.
Direkte Herstellung von Platten bzw. Schichten
Um den Umweg des Sägens von Wafern aus Kristallblöcken zu vermeiden, gibt es umfangreiche Aktivitäten, Solarzellen direkt zu erzeugen.
EFG-Verfahren
Beim EFG-Verfahren (Edge-defined Film-fed Growth) werden aus einer elektrisch beheizten Graphitwanne aus flüssigem Reinstsilizium achteckige Röhren von etwa 6 bis 7 m Länge nach oben gezogen. Die Ziehgeschwindigkeit liegt im Bereich von ca. 1mm/s. Die Kantenlänge der einzelnen Seiten beträgt 10 bzw. 12,5 cm, die Wandstärke ca. 280 µm. Nach Fertigstellung der Röhre wird diese entlang der Kanten mit NdYAG-Lasern geschnitten und in einem bestimmten Raster dann über die Breite der jeweiligen Seite. Daraus ergibt sich die Möglichkeit der Herstellung von Zellen mit unterschiedlichen Kantenlängen (zum Beispiel 12,5 x 15 cm oder 12,5 x 12,5 cm). Es wird eine Ausbeute von etwa 80 % des Ausgangsmaterials erzielt. Bei den so erzeugten Zellen handelt es sich ebenfalls um multikristallines Material, welche sich vom Aussehen her deutlich von den gesägten Zellen unterscheidet. Unter anderem ist die Oberfläche der Zellen welliger. Dieses Verfahren wird auch Bandzieh- oder Octagon-Verfahren genannt.
Das EFG-Verfahren wird von der Firma Schott Solar (Deutschland) angewendet. Entwickelt wurde das Verfahren von der Firma ASE Solar(USA).
String-Ribbon-Verfahren
Weiterhin gibt es noch ein Verfahren der US-amerikanischen Firma Evergreen Solar, bei dem die Wafer zwischen zwei Fäden direkt aus der Silizium-Schmelze gezogen werden. Hierbei entsteht weniger Abfall (wie Späne etc., die normalerweise direkt entsorgt werden) als bei den herkömmlichen Verfahren.
Schichttransfer-Verfahren
Beim Schichttransfer-Verfahren wird eine nur ca. 20 µm dünne Schicht aus einkristallinem Silizium direkt flach auf einem Substrat gezüchtet. Als Trägermaterial eignen sich keramische Substrate oder auch speziell oberflächenbehandeltes Silizium, wodurch das Ablösen des entstandenen Wafers und die Wiederverwendung des Trägers gegeben ist. Die Vorteile dieser Verfahren sind der deutlich geringere Siliziumbedarf durch die geringe Dicke und der Wegfall der Sägeverluste. Der Sägevorgang als zusätzlicher Prozessschritt entfällt. Der erreichbare Wirkungsgrad ist hoch und liegt im Bereich von monokristallinen Zellen.
Solarzellen aus „schmutzigem“ Silizium
Der Prozess des Zonenschmelzens und Dotierens lässt sich auch in eine bereits gefertigte, flache Platte bzw. Schicht verlagern. Das Prinzip ist, dass die Verunreinigungen durch Wärmebehandlung (mehrfach lateral fortschreitende Umschmelzung, z.B. mit Laserstrahlung) des Siliziums an wenigen Stellen konzentriert werden.[4].
Andere Solarzellentypen
Dünnschichtzellen
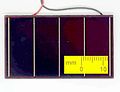


Dünnschichtzellen gibt es in verschiedenen Variationen, je nach Substrat und aufgedampften Materialien. Die Spannbreite der physikalischen Eigenschaften und der Wirkungsgrade ist entsprechend groß. Dünnschichtzellen unterscheiden sich von den traditionellen Solarzellen (kristallinen Solarzellen basierend auf Silizium-Wafern) vor allem in ihren Produktionsverfahren und durch die Schichtdicken der eingesetzten Materialien. Die physikalischen Eigenschaften amorphen Siliziums, die von kristallinem Silizium verschieden sind, beeinflussen die Solarzelleneigenschaften. Manche Eigenschaften sind auch noch nicht vollständig verstanden.
Auch bei kristallinen Solarzellen wird das Licht bereits in einer dünnen Oberflächenschicht (ca. 10 µm) absorbiert. Es liegt daher nahe, Solarzellen sehr dünn zu fertigen. Verglichen mit kristallinen Solarzellen aus Siliziumwafern sind Dünnschichtzellen etwa 100mal dünner. Diese Dünnschichtzellen werden meist durch Abscheiden aus der Gasphase direkt auf einem Trägermaterial aufgebracht. Dies kann Glas, Metallblech, Kunststoff oder auch ein anderes Material sein. Der aufwändige, im vorigen Kapitel beschriebene Prozess des Zerschneiden von Siliziumblöcken kann also umgangen werden.
Das gängigste Material für Dünnschichtzellen ist amorphes Silizium (a-Si:H). Solche Dünnschichtmodule sind langlebige Produkte. Outdoor-Tests zeigen stabile Wirkungsgrade über mehr als zehn Jahre.
Mögliche weitere Materialien sind mikrokristallines Silizium (µc-Si:H), Gallium-Arsenid (GaAs), Cadmium-Tellurid (CdTe) oder
Kupfer-Indium-(Gallium)-Schwefel-Selen-Verbindungen, die so genannten CIS-Zellen bzw. CIGS-Zellen, wobei hier je nach Zelltyp S für Schwefel oder Selen stehen kann.
CIS-Dünnfilmmodule erreichen inzwischen die gleichen Wirkungsgrade wie Module aus multikristallinem Silizium (11-12 %, [5]).
Für die Produktion von Strom ist ein hoher Wirkungsgrad erwünscht, den auch Dünnschichtmodule teilweise aufweisen. Wirkungsgrade im Bereich von 20% (19,2 % mit CIS-Solarzellen, siehe [6]) sind durchaus möglich.
Jedoch ist der Wirkungsgrad nicht das alleinige Kriterium bei der Auswahl. Wichtiger sind oft die Kosten, zu denen Strom aus den Solarzellen produziert werden kann. Dafür sind die verwendeten Herstellungsverfahren sowie die Kosten der eingesetzten Materialien verantwortlich.
Eine der Stärken der Dünnschichtmodule besteht darin, dass sie nicht auf ein rigides Substrat wie Glas oder Alu angewiesen sind. Bei aufrollbaren Solarzellen für den Wanderrucksack oder eingenäht in Kleider wird ein tieferer Wirkungsgrad in Kauf genommen; der Gewichtsfaktor ist wichtiger als die optimale Lichtumwandlung.
Eine weitere Stärke von Dünnschichtmodulen ist, dass sie einfacher und grossflächiger produziert werden können, insbesondere die Dünnschichtzellen aus amorphem Silizium. Diese machen daher heute den größten Marktanteil aus.
Zur Herstellung werden zum Teil Maschinen eingesetzt, die auch zur Herstellung von Flachbildschirmen eingesetzt werden. Hierbei werden Beschichtungsflächen von über 5 m² erreicht. Mit den Verfahren zur Herstellung von amorphem Silizium lässt sich auch kristallines Silizium in dünnen Schichten herstellen, sogenanntes mikrokristallines Silizium. Es vereint Eigenschaften von kristallinem Silizium als Zellenmaterial mit den Methoden der Dünnfilmtechnik. In der Kombination aus amorphem und mikrokristallinem Silizium wurden in den letzten Jahren beachtliche Wirkungsgradsteigerungen erzielt.
Ein Verfahren für die Fertigung kristalliner Dünnschichtzellen aus Silizium ist CSG, (Crystalline Silicon on Glass); dabei wird eine weniger als zwei Mikrometer dünne Siliziumschicht direkt auf einen Glasträger aufgebracht; die kristalline Struktur wird nach einer Wärmebehandlung erreicht. Das Aufbringen der Stromführung erfolgt mittels Laser- und Tintenstrahldrucktechnik. Dafür ist in Deutschland eine Fabrikationsanlage im Bau. Die Auslieferung der ersten Module wird für 2006 erwartet. (Quelle: CSG Solar)
Konzentratorzellen
Bei diesem Zellentyp wird Halbleiterfläche eingespart, indem das Sonnenlicht auf einen kleinen Bereich konzentriert wird. Dies erreicht man gewöhnlich durch Linsen, die im Vergleich zu Halbleitern in der Herstellung sehr billig sind. Häufig verwendete Materialien für Konzentratorsolarzellen sind III-V-Halbleiter, häufig in Tandem- oder Dreischicht-Bauweise. Sie arbeiten noch zuverlässig bei mehr als dem 500fachen der Sonnenintensität. Konzentratorsolarzellen benötigen darüber hinaus eine mechanische Nachführung der Optik zur Strahlungsbündelung an den Sonnenstand.
Elektrochemische Farbstoff-Solarzelle
Dieser Zelltyp ist auch bekannt als Grätzel-Zelle. Bei diesem Zelltyp wird der Strom anders als bei den bisher aufgeführten Zellen über die Lichtabsorption eines Farbstoffes gewonnen; als Halbleiter kommt Titandioxid zum Einsatz. Als Farbstoffe werden hauptsächlich Komplexe des seltenen Metalls Ruthenium verwendet, zu Demonstrationszwecken können aber selbst organische Farbstoffe, zum Beispiel der Blattfarbstoff Chlorophyll oder Anthocyane (aus Brombeeren), als Lichtakzeptor verwendet werden (diese besitzen jedoch nur eine geringe Lebensdauer). Die Funktionsweise der Zelle ist noch nicht im Detail geklärt; die kommerzielle Anwendung gilt als recht sicher, ist aber produktionstechnisch noch nicht in Sicht.
Organische Solarzellen
Organische Solarzellen benutzen Kohlenwasserstoffverbindungen, die elektrisch halbleitende Eigenschaften haben. In diesen organischen Halbleitern regt Licht ausreichend hoher Energie Exzitonen an, die aber nur eine kurze freie Weglänge haben. Daher werden häufig zwei organische Halbleiter mit leicht unterschiedlichen Energieniveaus verwendet, um so die Exzitonen zu trennen, bevor sie zerfallen. Der Wirkungsgrad liegt derzeit (Stand April 2007) bei maximal 6 % auf einer Fläche von 1cm². Es sind bisher keine organischen Solarzellen kommerziell erhältlich (Stand Januar 2007).
Fluoreszenz-Zelle
Hierbei handelt es sich um Solarzellen, die zunächst in einer Platte durch Fluoreszenz Licht größerer Wellenlänge erzeugen, um dieses an den Plattenkanten zu wandeln.
Geschichte
Hauptartikel: Geschichte der Fotovoltaik
Schon 1839 erkannte Alexandre Edmond Becquerel, dass eine Batterie, die von der Sonne beschienen wird, eine größere Leistung hervorbrachte als eine ohne Sonnenbestrahlung. Er nutzte den Potentialunterschied (Säurebad mit belichtetem und unbelichtetem Teil) zwischen einer verdunkelten und einer belichteten Seite einer chemischen Lösung, in die er zwei Platinelektroden eintauchte. Als er nun diese Konstruktion in die Sonne stellte, beobachtete er, dass ein Strom zwischen den zwei Elektroden entstand. So entdeckte er den photovoltaischen Effekt, konnte ihn allerdings noch nicht erklären. 1904 entdeckte der deutsche Physiker Philipp Lenard, dass Lichtstrahlen beim Auftreffen auf bestimmte Metalle Elektronen aus deren Oberfläche herauslösen, und lieferte damit die ersten Erklärungen für den Photoeffekt. Doch er wusste noch nicht genau, warum und bei welchen Metallen dies geschieht. Dennoch erhielt er für seine Entdeckung 1905 den Physiknobelpreis. Den endgültigen Durchbruch schaffte 1905 Albert Einstein, als er mit Hilfe der Quantentheorie die gleichzeitige Existenz des Lichtes sowohl als Welle als auch als Teilchen erklären konnte. Bis dahin glaubte man, dass Licht nur als eine Energie mit unterschiedlicher Wellenlänge auftritt. Doch Einstein stellte in seinen Versuchen, die Photovoltaik zu erklären, fest, dass sich Licht in manchen Situationen genauso wie ein Teilchen verhält, und dass die Energie jedes Lichtteilchens oder Photons nur von der Wellenlänge des Lichts abhängt. Er beschrieb das Licht als eine Ansammlung von Geschossen, die auf das Metall treffen. Wenn diese Geschosse genügend Energie besitzen, wird ein freies Elektron, das sich im Metall befindet und von einem Photon getroffen wird, vom Metall gelöst. Außerdem entdeckte er, dass die maximale kinetische Energie der losgelösten Elektronen von der Intensität des Lichtes unabhängig ist und nur durch die Energie des auftreffenden Photons bestimmt wird. Diese Energie hängt wiederum nur von der Wellenlänge und der Frequenz des Lichtes ab. Für seine Arbeit zur Photovoltaik erhielt er 1921 den Nobelpreis für Physik.
Die Entdeckung des p-n-Übergangs im Jahre 1949 durch William B. Shockley, Walther H. Brattain und John Bardeen war ein weiterer großer Schritt zur Solarzelle in ihrer heutigen Form. Nach diesen Entdeckungen stand dem Bau einer Solarzelle in ihrer heutigen Form nichts mehr entgegen. Es ist jedoch einem glücklichen Zufall zu verdanken, dass diese erste Solarzelle 1954 in den Laboratorien der amerikanischen Firma Bell gebaut wurde. Die Mitarbeiter der Firma beobachteten, als sie einen Gleichrichter, der mit Hilfe von Silizium arbeitete, untersuchten, dass dieser mehr Strom lieferte, wenn er in der Sonne stand, als wenn er zugedeckt war. Die Firma Bell entwickelte so die ersten Solarzellen. Diese hatten allerdings nur einen Wirkungsgrad von 4 bis 6 Prozent.
1958 wurden erstmals Solarzellen auf Satelliten getestet. Die dort erzielten Ergebnisse waren grandios - bis heute werden Raumflugkörper bis jenseits des Mars durch Solarzellen mit Strom versorgt und im Jahr 2011 soll mit Juno die erste mit Solarzellen ausgerüstete Raumsonde zum Jupiter starten. Es wurden Wirkungsgrade bis 10,5 % berechnet. Diese Ergebnisse waren jedoch nicht auf die Verhältnisse auf der Erdoberfläche übertragbar, da im Weltraum die natürliche Sonnenstrahlung keinen Tag-Nacht-Rhythmen und keiner Absorption durch Wolkendecken und Atmosphäre unterliegt. Andererseits führen die extremen Strahlungsverhältnisse im Weltraum zu einer stärkeren Degradation der Solarzellen als es auf der Erde der Fall ist. Seither versuchen Industrie und Forschung, immer größere Wirkungsgrade zu erreichen und zugleich die Degradation und Strahlungsresistenz zu verbessern.
Der theoretische Wirkungsgrad für Silizium-Solarzellen liegt bei 29 % für die Strahlungsverhältnisse in mittleren Breiten. Zu den Wirkungsgraden siehe auch technische Merkmale.
Bis gegen Ende der 1990er Jahre waren Zellen mit etwa 100 mm Kantenlänge (im Fachjargon auch Vier-Zoll-Zellen genannt) die üblichste Baugröße. Danach wurden auch 125 mm-Zellen verstärkt eingeführt, und seit etwa 2002 sind auch 150 mm-Zellen (Kantenlänge etwa 150 mm) für Standardmodule eine gängige Größe.
Dass man sich diese Energie aktiv zunutze machen kann, wußten schon die alten Griechen. Angeblich bündelten sie mit Spiegeln das Sonnenlicht bei der Belagerung von Syracus im Jahre 212 v. C. und richteten die gebündelten Sonnenstrahlen gegen die römische Flotte, deren Segel daraufhin zu brennen anfingen.
Die Griechen nutzen aber auch die Sonnenenergie zu friedlichen Zwecken wie zum Entfachen der olympischen Flamme im Tempel zu Delphi.
Die Nutzung der Sonne zur Gewinnung von elektrischer Energie kann man grob in das Jahr 1839 datieren. Der Franzose Antoine Becquerel stellte fest, dass eine Batterie, wenn man sie dem Sonnenlicht aussetzt, eine höhere Leistung hat als ohne Sonnenlicht. Später wies man nach, das auch andere Materialien wie Kupfer photoleitfähig sind.
Die Photoleitfähigkeit wurde bei Selen 1873 nachgewiesen. Zehn Jahre später wurde die erste „klassische“ Photozelle aus Selen gefertigt. Wiederum zehn Jahre später, 1893, wurde die erste Solarzelle zur Erzeugung von Elektrizität gebaut.
1904 entdeckt der deutsche Physiker Philipp Lenard, dass Lichtstrahlen beim Auftreffen auf bestimmte Metalle Elektronen aus deren Oberfläche herauslösen und lieferte damit die ersten Erklärungen für den Effekt der Photovoltaik. Ein Jahr später erhält er den Nobelpreis für Physik für die Erforschung des Durchganges von Kathodenstrahlen durch Materie und für seine Elektronentheorie.
Ein wieder sehr entscheidender Schritt hin zur Solarzelle ereignete sich 1949. W. Shockley entdeckt den Effekt des Kristallgleichrichters (pn-Übergang/Sperrschicht).
Somit waren von diesem Zeitpunkt an auch die praktischen Voraussetzungen zur Fertigung von Solarzellen geschaffen. Doch der Anstoß zur Konstruktion der ersten wirtschaftlichen Solarzelle aus Silizium entstand durch einen Zufall. Anfang der Fünfziger machten Wissenschaftler der „Bell-Telephone-Laboratorien“ in New Jersey eine überraschende Beobachtung: Gleichrichter, die mit Hilfe von Silizium (damals ein neues Material in der E-Technik) arbeiteten, lieferten mehr Strom, wenn sie im Sonnenlicht standen, als wenn sie abgedeckt waren. Morton Price war der Teamleiter bei Bell und fand die Ursache heraus. Bei Bell erkannte man schnell den Nutzen dieser Entdeckung zur Versorgung des Telefonnetzes von ländlichen Regionen mit Strom, was bis dahin noch mit Batterien geschah.
Die Firma Bell, genauer die Herren Chapin, Fuller und Pearson, entwickelte 1953 so die ersten Solarzellen aus Silizium, welche mit Arsen dotiert waren und einen Wirkungsgrad von etwa 4 % besaßen. Durch Wahl einer anderen Dotierung konnte der Wirkungsgrad auf etwa 6 % erhöht werden.
Die Raumfahrt erkannte sehr schnell den Nutzen der Solartechnik und rüstete 1958 den ersten Satelliten mit Solarzellen aus. Vanguard I startete am 17. März 1958, er besaß ein Solarpanel, welches mit 108 Si-Solarzellen ausgestattet war. Diese dienten nur als Ladestation der Akkus und nicht zur direkten Stromversorgung. Dabei wurde errechnet, dass die Zellen einen Wirkungsgrad von 10,5 % besaßen.
Somit arbeiteten die Solarzellen besser als erwartet. Die Techniker dachten, die Solarzellen würden die Batterien nicht in diesem Ausmaß unterstützen und schneller kaputt gehen, so dass man diesen Satelliten nicht mit einem „Ausschalter“ versehen hatte. Dieses hatte zur Folge, dass der Satellit noch fünf Jahre später munter Signale sendete und nicht ans Aufhören dachte. Nach acht Jahren ging der Satellit an Strahlenschäden kaputt.
Kurz darauf entstand die CdS-Cu2S-Solarzelle, die bis Anfang der 1990er noch in Satelliten eingesetzt wurden. Heutige Satelliten sind zum Vergleich mit Vanguard I mit rund 40.000 Solarzellen ausgestattet.
Im Weltraum steht der natürlichen Sonnenstrahlung im Vergleich zur Erdoberfläche nichts entgegen, keine Tag-Nacht-Rhythmen, keine Wolkendecken und keine mehr oder weniger saubere Atmosphäre, die das Sonnenlicht behindert.
Seit 1958 hat sich in der Solarzellen-Entwicklung einiges getan. Durch die Verwendung reineren Siliziums und besserer Dotierungsmöglichkeiten wurde der Wirkungsgrad gesteigert und die Lebensdauer erhöht.
Mandelkorn und Lamneck verbesserten die Lebensdauer der Zellen 1972 durch eine Reflexion der Minoritätsladungsträger, in dem sie ein sogenanntes black surfaces field (BSF) in die p-leitende Schicht einbrachten. 1973 stellten Lindmayer und Ellison die sog. violette Zelle vor, die bereits einen Wirkungsgrad von 14 % besaß. Durch das Reduzieren des Reflexionsvermögens 1975 wurde der Wirkungsgrad auf 16 % gesteigert. Diese Zellen heißen CNR-Solarzellen (Comsat Non Reflection; Comsat = Telefonsatellit ) und wurden für Satelliten entwickelt.
Inzwischen sind von Green sowie an der Stanford Universität und bei Telefunken Solarzellen mit Wirkungsgraden um 20 % entwickelt worden. Maßgeblicher Anstoß für diese Entwicklung war Anfang der Siebziger die Vervierfachung des Ölpreises. Bis dahin kostete jedes Watt 200 Dollar und das sprach nicht gerade für eine rosige Zukunft der Solarzelle in der Energiepolitik jener Zeit. Nach dieser Preissteigerung rief Richard Nixon 1974 ein Forschungsprogramm ins Leben, welches sich mit regenerativen Energien auseinander setzte. Um die Akzeptanz und das Vertrauen bei der Bevölkerung zu gewinnen, wurden Anfang der 1980er Rennen mit Solarmobilen ausgetragen, und im Juli 1981 überquerte ein mit Solarkraft angetriebenes Flugzeug den Ärmelkanal.
Formen und Größen
Zu Beginn der Kommerzialisierung der Solartechnik wurden häufig runde Zellen eingesetzt, deren Ursprung von den meist runden Siliziumstäben der Computerindustrie herrührt. Inzwischen ist diese Zellenform relativ selten, und es werden quadratische Zellen oder fast quadratische mit mehr oder weniger abgeschrägten Ecken eingesetzt. Als Standardformate werden derzeit Wafer mit einer Kantenlänge von 125 und 150 mm prozessiert; künftig sollen aber auch Zellen mit einer Kantenlänge von 200 mm Bedeutung erlangen.
Durch Sägen der fertig prozessierten Zellen entstehen für spezielle Anwendungen im Kleingerätebereich auch Zellen mit kleineren Kantenlängen. Sie liefern annähernd die gleiche Spannung wie die großen Zellen, jedoch entsprechend der kleineren Fläche einen kleineren Strom.
Im EFG-Verfahren werden auch Zellen hergestellt, bei denen die Seiten des entstehenden Rechtecks nicht die gleichen Längen haben.
Degradation
Unter dem Begriff Degradation wird die alterungsbedingte Änderung der Parameter von Halbleiterbauteilen verstanden - in diesem Fall der Rückgang des Wirkungsgrades von Solarzellen im Laufe ihres Lebens.
Üblicherweise betrachtet man hierbei einen Zeitraum von bis zu 25 Jahren. Der Verlust an Wirkungsgrad liegt etwa im Bereich von 10 % bzw. 13 % in dem Zeitraum von 20 bzw. 25 Jahren. Solarzellen im Weltraum altern wesentlich schneller, da sie einer höheren Strahlung ausgesetzt sind.
Nachlassende Wirkungsgrade bzw. Stromerträge bei Solarmodulen haben aber oft banalere Ursachen: allgemeine flächige Verschmutzung der Modulgläser; Veralgung ("Verpilzen") speziell vom Modulrahmen ausgehend, mit Teilabschattung der Zellen; wachsende Bäume und Sträucher die eine Teilabschattung bewirken und bei der Installation noch deutlich kleiner waren; Vergilbung des polymeren Einbettungsmaterials, welches den Kontakt Zelle - Glas bewerkstelligt.
kristalline Solarzellen
Bei heutigen Solarzellen beträgt der anfängliche Wirkungsgrad ca. 12 - 17 %. Oft geben die Hersteller von Solarzellen eine Mindestgarantie von 80 - 85 % (Peak-Leistung) auf ihre Produkte nach 20 Jahren. Es ergeben sich also selbst nach langer Laufzeit (Betrieb) recht maßvolle Verluste, welche die/den Installation/Langzeiteinsatz einer Solaranlage rechtfertigen.
Für die Degradation verantwortlich sind im wesentlichen rekombinationsaktive Defekte, die die Ladungsträgerlebensdauer auf ca. 10% ihres Anfangswertes senkt (lichtinduzierte Degradation). Verantwortlich für die lichtinduzierte Degradation ist die Bildung von Bor-Sauerstoff-Komplexen in Czochralski-Silizium.
amorphe Siliziumsolarzellen
Eine besonders hohe Degradation von bis zu 25 % erreichen Solarzellen aus amorphem Silizium im ersten Betriebsjahr. Für Solarmodule aus diesem Material wird jedoch nicht die Leistung zu Beginn der Lebenszeit, sondern die Leistung nach dem Alterungsprozess in den Datenblättern und beim Verkauf angegeben. Solarmodule aus diesem Material haben also zunächst eine höhere Leistung als die, für die man bezahlt hat. Die Degradation, auch Staebler-Wronski-Effekt (SWE) genannt, erfolgt unter Lichteinstrahlung. Dabei erfährt das metastabile amorphe hydrogenierte Silizium (a-Si:H) eine Zunahme der Defektdichte um etwa eine Größenordnung, bei gleichzeitiger Abnahme der Leitfähigkeit und Verschiebung des Fermi-Niveaus in die Mitte der Bandlücke. Nach etwa 1000 Sonnenstunden erreichen a-Si-Zellen einen stabilen Sättigungswert für den Wirkungsgrad.
Technische Merkmale
Die Kenngrößen einer Solarzelle werden für normierte Bedingungen (STC, Standard Test Conditions) angegeben:
- Einstrahlungstärke von 1000 W/m2 in Modulebene,
- Temperatur der Solarzelle 25 °C konstant,
- Strahlungspektrum AM 1,5 global; DIN EN 61215, IEC 1215, DIN EN 60904, IEC 904).
Hierbei steht AM 1,5 global für den Begriff Air Mass, die 1,5 dafür, dass die Sonnenstrahlen hierbei das 1,5-fache der Atmosphärenhöhe durchlaufen, weil sie schräg auftreffen. Dies entspricht sehr gut den sommerlichen Gegebenheiten in Mitteleuropa von Norditalien bis Mittelschweden. Im Winter steht die Sonne in unseren Breiten erheblich tiefer, und ein Wert von AM 4 bis AM 6 ist hier realistischer.
Durch die Absorption in der Atmosphäre verschiebt sich auch das Spektrum des auf das Modul treffenden Lichtes. "Global" steht für Globalstrahlung, die sich aus dem Diffus- und dem Direktstrahlungsanteil der Sonne zusammensetzt.
Hierbei ist zu beachten, dass in der Realität insbesondere die Zellentemperatur bei einer solchen Einstrahlung, die in Deutschland im Sommer zur Mittagszeit erreicht wird, bei normalem Betrieb wesentlich höher liegt (je nach Anbringung, Windanströmung etc. kann sie zwischen etwa 30 und 60 °C liegen). Eine erhöhte Zellentemperatur bedeutet aber gleichzeitig einen herabgesetzten Wirkungsgrad der Solarzelle. Aus diesem Grund wurde auch eine weitere Bezugsgröße geschaffen, PNOCT, die Leistung bei normaler Betriebstemperatur (normal operating cell temperature).

Gebräuchliche Abkürzungen für die Bezeichnungen sind
- SC: Short Circuit - Kurzschluss
- OC: Open Circuit - Leerlauf
- MPP: Maximum Power Point - Betriebspunkt maximaler Leistung
- PR: Performance Ratio Qualitätsfaktor gibt an, welcher Teil des vom Solargenerators erzeugten Stromertrages(unter Nennbedingungen) real zur Verfügung stehen.
Die Kennwerte einer Solarzelle sind
- Leerlaufspannung (auch )
- Kurzschlussstrom
- Spannung im bestmöglichen Betriebspunkt (auch )
- Strom im Betriebspunkt mit maximaler Leistung
- Maximale erzielbare Leistung
- Füllfaktor
- Koeffizient für die Leistungsänderung mit der Zelltemperatur
- Zellwirkungsgrad mit der bestrahlten Fläche A und der Bestrahlungsstärke
Solarzellen können also eine Leistung von sehr grob 160 W/m² abgeben. Eingebaut in ein Modul ist die Leistung pro Fläche geringer, da zwischen den Zellen und zum Modulrand Abstände vorhanden sind.
Der Wirkungsgrad einer Solarzelle ist das Verhältnis von erzeugter elektrischer Leistung zur Leistung der Globalstrahlung. Halbleiter mit fester Bandlücke nutzen nur einen Teil des Sonnenlichtes. Ihr maximaler theoretischer Wirkungsgrad liegt bei ca. 30 %. Der maximale theoretische Wirkungsgrad bei Multibandsystemen, die für alle Wellenlängen Farben des Sonnenlichts sensibilisiert sind, liegt bei ca. 85 %.
| Materialsystem | Wirkungsgrad (AM1,5) | Lebensdauer | Modul-Kosten [7] |
|---|---|---|---|
| amorphes Silizium | 5-10 % | < 20 Jahre | |
| polykristallines Silizium | 10-15 % | 25-30 Jahre | 3 EUR/W |
| monokristallines Silizium | 15-20 % | 25-30 Jahre | 10 EUR/W |
| Galliumarsenid (Einschicht) | 15-20 % | ||
| Galliumarsenid (Zweischicht) | 20 % | ||
| Galliumarsenid (Dreischicht) | 25 % (30% bei AM0) | >20 Jahre | 20-100 EUR/W |
| Galliumindiumnitrid |
Der Wirkungsgrad kommerzieller Zellen liegt bei ca. 20 Prozent (siehe Tabelle). Damit hergestellte Solarmodule erreichen einen Gesamtwirkungsgrad von etwa 17 Prozent. Der Rekord für im Labor hergestellte Silizium-Solarzellen liegt bei 24,7 Prozent (University of New South Wales, Australien), mit denen Module mit über 22 Prozent Wirkungsgrad hergestellt wurden. Der Preis für diese im Zonenschmelzverfahren hergestellten Zellen liegt bei etwa 200 Euro pro Zelle bei einer Zellfläche von 21,6 cm2, entsprechend einem Preis von 5-10 EUR/W. Für GaAs-Systeme beträgt er das fünf- bis zehnfache.
Die Degradation des Wirkungsgrades (Alterungsverhalten) liegt bei ca. 10 Prozent in 25 Jahren. Hersteller geben beispielsweise Garantien auf mindestens 80 Prozent der Peak-Leistung nach 20 Jahren.
Im Weltraum ist einerseits die Solarkonstante größer als die Globalstrahlung auf der Erde, andererseits altern die Solarzellen schneller. Solarpanele für Satelliten erreichen zur Zeit (2005) einen Wirkungsgrad von fast 25 % [8] bei einer Betriebszeit von 15 Jahren.
Schaltbilder

Das Schaltsymbol einer Solarzelle gibt, wie das Schaltsymbol einer Diode oder Fotodiode, mit einem Pfeil die technische Stromrichtung zur Verschaltung an. Der Kennlinienverlauf einer realen Solarzelle weicht allerdings von der einer idealen Fotodiode ab. Um diese Abweichungen zu modellieren, existieren mehrere Ersatzschaltbilder.
Vereinfachtes Ersatzschaltbild
Das Schaltbild besteht zunächst nur aus einer Stromquelle, die parallel zu einer idealen Diode geschaltet wird. Diese produziert einen Strom, der von der Bestrahlungsstärke abhängt und den Photostrom modelliert. Die Gesamtstromstärke ergibt sich damit mit dem Diodenstrom (siehe Diode) zu .
Erweitertes Ersatzschaltbild (Ein- und Zweidiodenmodell)

Das erweiterte Ersatzschaltbild nimmt Rücksicht auf reale Faktoren des Bauelementes, die durch die Fertigung entstehen. Mit diesen Modellen soll ein möglichst realistisches Modell der tatsächlichen Solarzelle geschaffen werden.
Beim Eindiodenmodell wird so das vereinfachte Ersatzschaltbild zunächst nur durch einen parallel und einen in Reihe geschalteten Widerstand ergänzt.
- Der Parallelwiderstand Rp symbolisiert Kristallfehler, nichtideale Dotierungsverteilungen und andere Materialdefekte, durch die Verlustströme entstehen, die den p-n-Übergang überbrücken. Bei Solarzellen aus guter Herstellung ist dieser Widerstand relativ groß.
- Mit dem Serienwiderstand Rs werden alle Effekte zusammengefasst, durch die ein höherer Gesamtwiderstand des Bauelementes entsteht. Das sind hauptsächlich der Widerstand des Halbleitermaterials, der Widerstand an den Kontakten und der Zuleitungen. Diese Größe sollte bei gefertigten Solarzellen möglichst gering sein.
Die Formel für den Gesamtstrom ist für dieses Modell bereits eine rekursive Funktion und lautet

Beim Übergang zum Zweidiodenmodell fügt man eine weitere Diode mit einem anderen Idealitätsfaktor n ein. Normalerweise werden diese über die Werte 1 und 2 angesetzt.
Weiterhin lassen sich alle diese Modelle bei Betrieb in Sperr-Richtung durch eine spannungsgesteuerte Stromquelle ergänzen, um den Lawinendurchbruch zu modellieren. Die Formeln für die Ströme beim Zweidiodenmodell lauten dann, bei Anpassungs-Leitwert gb, Durchbruchspannung Ub und Lawinendurchbruchexponent nb:
Energetische Amortisation und Erntefaktoren
Die energetische Amortisation ist der Zeitpunkt, zu dem die Energie, die für die Herstellung einer Photovoltaikzelle aufgewandt wurde, durch selbige wieder erzeugt wurde. Am besten schneiden Dünnschichtzellen ab. Ein Solarmodul (ohne Rahmen) mit solchen Zellen amortisiert sich nach etwa 2 - 3 Jahren. Polykristalline Solarzellen benötigen zur energetischen Amortisation etwa 3 - 5 Jahre und monokristalline Solarzellen benötigen 4 - 6 Jahre. Da eine Solaranlage nicht nur aus den Modulen, sondern u.a. noch aus einem Montagesystem und einem Wechselrichter besteht, erhöht sich die Dauer der energetischen Amortisation einer Solaranlage gegenüber einem Solarmodul um etwa ein Jahr.[9]
Umweltschutz
Die Herstellung einer Solarzelle ist ein chemischer Prozess, beim dem gasförmige, flüssige und feste Chemikalien zum Einsatz kommen, die zum Teil stark gesundheits- und umweltschädlich sind.
Die Photovoltaik unterscheidet sich in diesem Aspekt von anderen Technologien, die auf die Nutzung regenerativer Energieformen abzielen.
Für Laien sind die Gesundheits- und Umweltrisiken nur schwer zu erkennen.
Thematisiert werden müssen: a) die Gesundheitsgefahren für die Beschäftigten in der industriellen Solarzellenherstellung; b) die Gefährdung der Umwelt durch die Abfälle und Emissionen aus der großindustriellen Solarzellenproduktion; c) die Gefährdung der Umwelt durch Solarschrott; d) die umweltschonenden Aufarbeitung, Entsorgung bzw. Endlagerung von Solarschrott und Abfällen aus der Solarzellenproduktion.
Bereits im Vorfeld hilft eine vorausschauende und kritisch-selektive Förderung umweltfreundlicher Solarzellentechnologien.
Hersteller von Solarzellen (Auswahl)
Deutschland
- ErSol Solar Energy AG, Erfurt (Thüringen)
- Q-Cells AG, Thalheim (Sachsen-Anhalt)
- Solarworld AG, Bonn
Außerhalb Deutschlands
- GE Energy - Solar Power (USA) (früher Astropower)
- Kyocera, Kyoto (Japan)
- Mitsubishi Electric, Tokio (Japan)
- Sanyo, Osaka (Japan)
- Sharp, Osaka (Japan) - Anteil am Weltmarkt für Solarzellen ca. 30%
- SunPower, USA
Andere Firmen der Solarbranche
- Oerlikon, Trübbach, Schweiz (CH) Hersteller von Produktionsanlagen und Gesamtlösungen zur Produktion von Solarmodulen
- Applied Materials, Santa Clara (USA) Hersteller von Produktionsanlagen für Solarzellen
- Roth & Rau AG, Hohenstein-Ernstthal (Germany) Hersteller von Produktionsanlagen für Solarzellen und Turnkey Facility Solutions
- Schmid, Freudenstadt (Germany) u.a. Hersteller von Produktionsanlagen für Solarzellen.
Quellen
- ↑ M. A. Green, K. Emery, D. L. King, Y. Hishikawa and W. Warta, Solar Cell Efficiency Tables (Version 28), Prog. Photovolt: Res. Appl. 14, 455–461(2006)
- ↑ Neue Zürcher Zeitung vom 7. Dezember 2005, [1]
- ↑ Indium Vorräte laut USGS Mineral Commodity Summaries (2006), [2]
- ↑ [3]
- ↑ M. Powalla and B. Dimmler. CIGS solar modules - progress in pilot production, new developments and applications. 19th European Photovoltaic Solar Energy Conference, (2004) Paris, Ed.: JRC, Ispra, Italy, 1663)
- ↑ K. Ramanathan, M. A. Contreras, C. L. Perkins, S. Asher, F. S. Hasoon, J. Keane, D. Young, M. Romero, W. Metzger, R. Noufi, J. Ward and A. Duda. Properties of 19.2 % Efficiency ZnO/CdS/CuInGaSe2 Thin-film Solar Cells. Prog. Photovolt. Res. Appl. 11, 225-30 (2003)
- ↑ http://oregonstate.edu/~ecclese/files/Term%20Paper.pdf
- ↑ http://www.esa.int/techresources/ESTEC-Article-art_print_friendly_1115706332477.html
- ↑ V. Quaschning (2002): Energieaufwand zur Herstellung regenerativer Anlagen, [4]
Weblinks
- Commons: Solarzelle – Album mit Bildern, Videos und Audiodateien
- Commons: Fotovoltaikanlage – Album mit Bildern, Videos und Audiodateien
- Hahn-Meitner-Institut Berlin Entwicklung von Dünnschichtsolarzellen
- Photon - auflagenstärkste deutsche Solarstromzeitschrift
- Photon International - führende internationale Solarstromzeitschrift
- PV-Uni-Netz.de
- Solarserver.de
- Bundesverband Deutscher Solarstrom
- Ångström Solar Center (Uppsala) (englische Seite)
- Informationen rund um die Finanzierung von Solaranlagen
- Informationsportal für solares Gestalten und Bauen
- aktuelle Studie zur Energierücklaufzeit im Rahmen des Crystal-Clear-Projekts der EU
- Forschungsverbund Sonnenenergie: Solarzellen
- Institut für Solarenergieforschung Hameln
- Fraunhofer Institut Solare Energiesysteme
- Java-Applet zur Funktionsweise einer Silizium-Solarzelle (engl.)












![{\displaystyle I=I_{Ph}-I_{D}=I_{Ph}-I_{S}\left[e^{\frac {U_{D}}{n\cdot U_{T}}}-1\right]}](/media/api/rest_v1/media/math/render/svg/f5f71af916e5866e2531dd42e565f9102608882d)
![{\displaystyle I=I_{ph}-I_{d}-{\frac {U_{p}}{R_{p}}}=I_{ph}-I_{S}\left[e^{\frac {U+R_{s}\cdot I}{n\cdot U_{T}}}-1\right]-{\frac {U+R_{s}\cdot I}{R_{p}}}}](/media/api/rest_v1/media/math/render/svg/c8db76f53f429202ff27d88c61b0fc8ad8d7775b)
![{\displaystyle I=I_{ph}-I_{b}-I_{S1}\left[e^{\frac {U+R_{s}\cdot I}{n_{1}\cdot U_{T}}}-1\right]-I_{S2}\left[e^{\frac {U+R_{s}\cdot I}{n_{2}\cdot U_{T}}}-1\right]-{\frac {U+R_{s}\cdot I}{R_{p}}}}](/media/api/rest_v1/media/math/render/svg/6ffc5426aa7b93c612162f24cc069569c594e3a3)
